
Europas Mobilitätsbegleiter.
Weit mehr als nur Pannenhilfe!
Rufen Sie uns an
+49 711 530 34 35 36
täglich 24h erreichbar
Schreiben Sie uns eine E-Mail
notruf@ace.de
Rufen Sie uns an
+49 711 530 33 66 77
Schreiben Sie uns eine E-Mail
info@ace.de
Ab 2035 dürfen in der EU nur noch Autos und Transporter neu zugelassen werden, die keine klimaschädlichen Treibhausgase ausstoßen. Und auch die Liste der Städte, Regionen und Länder, die ein Zulassungsverbot für Pkw mit Verbrennungsmotor diskutieren und beschlossen haben, wird immer länger.
Aber warum gibt es diese Zulassungsverbote überhaupt?
Oberstes Ziel ist die Reduktion klimaschädlicher Emissionen. Ein wichtiger Meilenstein dazu ist die 1992 von der internationalen Staatengemeinschaft beschlossene Klimarahmenkonvention. Diese soll die globale Erwärmung möglichst vermeiden bzw. verlangsamen und so auch die Folgen der Klimaerwärmung für Mensch und Natur abmildern. Bis heute haben 197 Vertragsparteien inklusive der EU die Klimarahmenkonvention unterschrieben und damit die völkerrechtliche Basis für weltweiten Klimaschutz geschaffen.
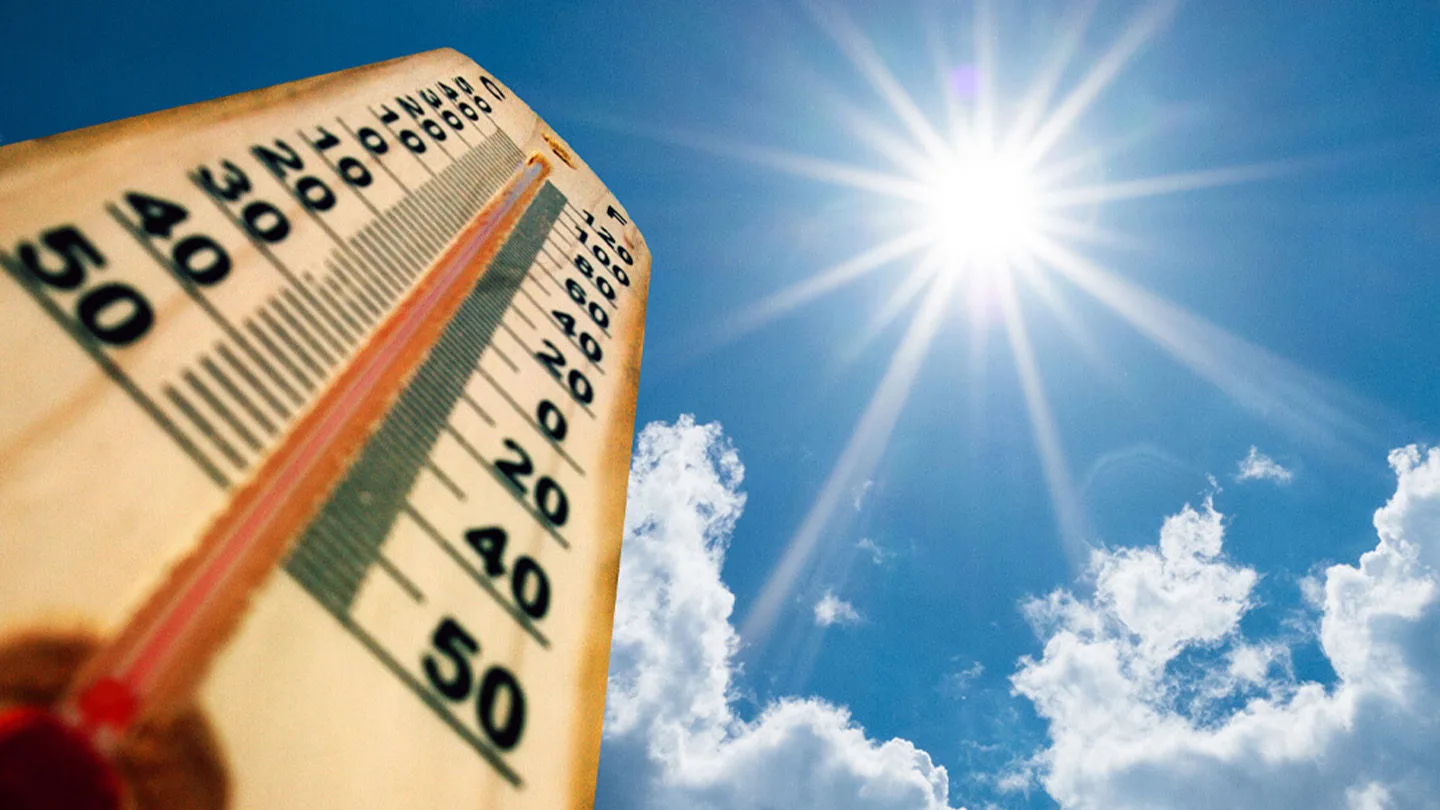
Teil dieser Klimarahmenkonvention ist auch das 2015 in Paris beim Klimagipfel beschlossene Ziel, den Anstieg der globalen Mitteltemperatur auf deutlich unter 2 °C und möglichst auf 1,5 °C gegenüber dem vorindustriellen Temperaturniveau zu begrenzen. Zudem hat sich die EU im Dezember 2020 gegenüber den Vereinten Nationen verpflichtet, ihre Treibhausgasemissionen bis zum Jahr 2030 um mindestens 55 Prozent gegenüber 1990 zu verringern.

Die EU will 2050 klimaneutral sein. Hierfür hat die EU-Kommission als Zwischenschritt das "Fit-for-55"-Klimapaket vorgestellt. Die dort enthaltenen Vorschläge mit einer Reihe verschiedener Maßnahmen für mehrere Bereiche wurde 2024 vom Rat der Europäischen Union und vom Europäischen Parlament angenommen.
Ein Vorschlag davon ist das vorgesehene Verbrenner-Aus ab 2035. In der Folge müssen Neuwagen in der EU ab dem Jahr 2035 CO2-emissionsfrei sein. Alle bis dahin zugelassenen Verbrenner-Pkw dürfen weiter gefahren werden. Zudem wird es mit E-Fuels alternative Kraftstoffe zur Betankung von Verbrennern geben, die nicht auf fossilen Energiequellen beruhen.
Die Europäische Union hat im Rahmen des „Fit-for-55“-Pakets die CO₂-Flottengrenzwerte für Pkw und leichte Nutzfahrzeuge deutlich verschärft. Ab dem 1. Januar 2035 gilt für neue Pkw und leichte Nutzfahrzeuge ein flottenweiter Zielwert von 0 g CO₂/km. Das bedeutet, dass ab diesem Zeitpunkt nur noch Nullemissionsfahrzeuge neu zugelassen werden. Für die Erfüllung der Flottenziele bis 2035 gibt es zudem unterschiedliche Flexibilitäten.
Es gibt kein generelles Verbot bestimmter Motortypen. Bestandsfahrzeuge mit Verbrennungsmotor sind demnach nicht betroffen und dürfen weiterhin genutzt und weiterverkauft werden.
Die EU hat inzwischen die Überprüfung des Regelwerks vorgezogen und wird die geplante Überprüfung der Regelung, die ursprünglich für 2026 vorgesehen war, im Dezember 2025 durchführen.
Der Rechtsrahmen wurde im Rahmen des ordentlichen Gesetz-gebungsverfahrens der Europäischen Union beschlossen. Die Europäische Kommission hat den Vorschlag vorgelegt, der anschließend vom Europäischen Parlament und dem Rat der EU (Mitgliedstaaten) verhandelt und verabschiedet wurde. Änderungen an dieser Regelung sind nur durch ein erneutes Gesetzgebungsverfahren möglich.
Es gibt gestufte Zielwerte, die bereits vor 2035 erreicht werden müssen. So gelten beispielsweise ab 2025 verschärfte CO₂-Grenzwerte, die insbesondere ab 2030 noch einmal verschärft werden. Ursprünglich war eine Überprüfung der Regelung für 2026 vorgesehen. Diese wurde inzwischen vorgezogen, sodass die Europäische Kommission die Wirksamkeit und Umsetzbarkeit der Vorschriften bereits bis Ende 2025 bewerten will. Ob Anpassungen am Zeitplan oder an den Mechanismen vorgenommen werden, bleibt somit offen.
Die politische Bewertung des Verbrenner-Aus ab 2035 fällt innerhalb der Europäischen Union sehr unterschiedlich aus. Befürworter (darunter Sozialdemokraten, Grüne und zahlreiche Umweltorganisationen) betrachten die Regelung als notwendige Voraussetzung, um die europäischen Klimaziele zu erreichen. Sie betonen, dass nur ein klarer Zeitplan für das Aus für emissionsintensive Fahrzeuge Planungssicherheit für Industrie und Verbraucher schafft.
Kritische Stimmen kommen vor allem aus Teilen der Europäischen Volkspartei, von Mitgliedstaaten mit einer stark ausgeprägten Automobilindustrie sowie von Interessenvertretungen der Auto-Branche. Sie argumentieren, dass die Vorgabe Risiken für Arbeitsplätze, Wettbewerbsfähigkeit und Rohstoffabhängigkeiten birgt und eine einseitige Ausrichtung auf batterieelektrische Fahrzeuge problematisch sei.
Vor diesem Hintergrund hat die Europäische Kommission angekündigt, die Regelung bereits vor 2026 einer Überprüfung zu unterziehen. Ziel dieser Überprüfung ist es, die Umsetzbarkeit im Hinblick auf Infrastruktur, Lieferketten und internationale Wettbewerbsfähigkeit zu bewerten und gegebenenfalls Anpassungen vorzunehmen.
Auch jegliche Art von Hybrid-Fahrzeuge (inkl. Plug-Ins) darf nach 2035 nicht mehr neu zugelassen werden. Sie werden zusätzlich durch einen Verbrennungsmotor mit Energie versorgt und / oder angetrieben. Der VDA setzt sich derzeit sehr stark dafür ein, dass Hybride auch noch nach 2035 zugelassen werden können, um der Industrie mehr Flexibilität zu ermöglichen.
Im März 2023 hat die Bundesregierung auf EU-Ebene durchgesetzt, dass die Neuzulassung von Fahrzeugen mit Verbrennungsmotor auch nach dem Jahr 2035 weiterhin möglich ist, sofern diese ausschließlich mit E-Fuels betrieben werden. Die Europäische Union arbeitet derzeit an der Einführung einer speziellen Fahrzeugkategorie („e-fuels only“), die eine formale Zulassung für ausschließlich mit synthetischen Kraftstoffen betriebene Fahrzeuge vorsieht.
Derzeit sind E-Fuels allerdings keine preisliche Alternative zu fossilen Kraftstoffen, da sie teuer sind und die Produktion noch nicht in relevanten Mengen erfolgen kann. In der Luftfahrt und in der Schifffahrt können E-Fuels in der Zukunft eine bedeutende Rolle spielen. Für Pkw werden sie auf Dauer aufgrund der hohen Preise keine große Rolle spielen.
Ja, das Verbot betrifft ausschließlich Neuzulassungen ab 2035. Bereits zugelassene Fahrzeuge (und damit auch Fahrzeuge mit Verbrennungsmotordürfen weiterhin betrieben, verkauft und genutzt werden.
Der Anteil reiner Elektroautos an den weltweiten Pkw-Neuzulassungen könnte bis 2030 auf etwa 40 Prozent und bis 2035 auf rund 60 Prozent steigen. Das hat die aktuelle Powertrain-Studie 2025 der Unternehmensberatung Strategy& ergeben. Die tatsächliche Entwicklung hängt jedoch stark von Rahmenbedingungen wie Ladeinfrastruktur, Strompreisen, Rohstoffverfügbarkeit und auch staatlichen Förderungen ab.
Bei den Verbraucherinnen und Verbrauchern zeigt sich eine wachsende Verunsicherung. Viele sind irritiert vom politischen Diskurs rund um das Aus für Verbrennungsmotoren und fragen sich, ob sich ein Umstieg auf E-Mobilität schon jetzt lohnt.
In der Automobilindustrie zeigt sich ein ambivalentes Bild: Einerseits haben sich viele Hersteller klar zur E-Mobilität bekannt und investieren massiv in neue Modelle und Produktionskapazitäten. Andererseits gibt es Skepsis, ob Absatz, Ladeinfrastruktur und politische Rahmenbedingungen den Umstieg in der gewünschten Geschwindigkeit ermöglichen können.
Der Begriff „Technologieoffenheit” bezeichnet einen Ansatz, bei dem der Gesetzgeber keine bestimmte Antriebstechnologie vorschreibt, sondern lediglich das Ziel, beispielsweise die Reduktion von CO₂-Emissionen, festlegt. Unternehmen können dann frei entscheiden, mit welcher Technologie sie dieses Ziel erreichen.
Genau dies ist beim sogenannten „Verbrenner-Aus 2035“ geschehen. Nicht Motortypen wurden verboten, sondern ein Ziel definiert. Wie dies erreicht werden kann, wird den Herstellern überlassen: Stand heute sind verschiedene Lösungen denkbar: Der Elektromotor, sowie der Wasserstoff-Verbrennungsmotor, bei dem ebenfalls kein CO2 ausgestoßen wird. Grundsätzlich ermöglicht die Regelung auch den Einsatz der Brennstoffzelle (z.B. Methanol, Wasserstoff), sowie die Verwendung von CO2-neutralen Kraftstoffen wie E-Fuels.
In der politischen Diskussion wird "Technologieoffenheit" allerdings oft als Argument für die Berücksichtigung von synthetischen Kraftstoffen (E-Fuels), oder Hybriden verwendet. Kritiker betonen jedoch, dass diese Alternativen mit höheren Energieverlusten und vor allem auch mit höheren Kosten verbunden sind und nicht in gleichem Umfang zeitlich verfügbar sein werden wie batterieelektrische Lösungen (BEVs).
Mehrere internationale Hersteller haben sich bereits eindeutig für die Transformation hin zur Elektromobilität entschieden. So produziert Polestar heute bereits ausschließlich batterieelektrische Fahrzeuge, nachdem sie zunächst mit Plug-Ins gestartet war. Auch NIO setzt konsequent auf Elektrofahrzeuge und investiert zusätzlich in innovative Batterietechnologien wie das Batteriewechselsystem. Tesla verfolgt seit seiner Gründung eine reine Elektroauto-Strategie und ist weiterhin in der Software-Entwicklung sehr einflussreich.
Unter den europäischen Herstellern zeichnet sich ein differenzierteres Bild ab. Audi hat einen klaren Ausstiegsplan: Ab 2026 sollen nur noch vollelektrische Modelle eingeführt werden und die Produktion von Verbrennern soll bis etwa 2033 beendet sein. BMW hingegen verfolgt eine flexiblere Strategie. Bis 2030 sollen rund die Hälfte der weltweiten Verkäufe elektrisch sein, doch ein klares Enddatum für den Verbrennungsmotor legt der Konzern nicht fest. Je nach Marktbedingungen möchte BMW auch weiterhin Hybrid- und Verbrennermodelle anbieten. Ursprünglich hatte Mercedes-Benz das Ziel formuliert, bis 2030 ausschließlich Elektrofahrzeuge zu verkaufen, sofern es die Marktbedingungen erlauben. Dieses Ziel wurde inzwischen abgeschwächt: Zwar sollen E-Fahrzeuge und Plug-in-Hybride den Großteil des Portfolios ausmachen, doch bleiben Verbrenner in bestimmten Regionen länger verfügbar.
Anders hingegen ist die Strategie von Volkswagen, da der Konzern vor allem den Massenmarkt bedient. VW plant, bis 2030 mindestens 80 Prozent seiner Verkäufe in Europa auf Elektrofahrzeuge umzustellen. Außerdem ist der Ausstieg aus den Verbrennungsmotoren in Europa zwischen 2033 und 2035 geplant. Um Elektromobilität für breite Käuferschichten erschwinglicher zu machen, hat der Konzern mit dem „ID.Polo“ ein Kompaktmodell angekündigt, das ab rund 25.000 Euro erhältlich sein soll. Für 2027 ist zudem ein weiteres Fahrzeug im Segment um 20.000 Euro geplant und bewusst als Einstiegsmodell für „Alltagskunden” positioniert wird. Damit übernimmt VW eine Schlüsselrolle bei der Elektrifizierung jenseits des Premiumsegments.
Tankstellen entwickeln sich zunehmend zu multifunktionalen „Mobility-Hubs“. Neben den klassischen Zapfsäulen für Benzin und Diesel werden zunehmend Schnellladepunkte für Elektroautos integriert. Betreiber investieren in Schnellladeparks, um den Anforderungen der Elektromobilität gerecht zu werden. Gleichzeitig ist absehbar, dass kleinere oder weniger frequentierte Tankstellen verschwinden könnten, während zentral gelegene Tankstellen als kombinierte Energiehubs bestehen bleiben.


